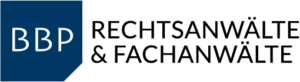Berufen auf fehlende Belehrung über die Anzeigepflichtverletzung bei arglistiger Täuschung im Allgemeinen ausgeschlossen
Bei Verdacht auf arglistige Täuschung steht dem Versicherer das Recht zu, einen Vertrag anzufechten und bei Nachweis arglistigen Handelns davon zurückzutreten, selbst wenn er den Versicherungsnehmer nicht wirksam über die Rechtsfolgen bei vorvertraglicher Anzeigenpflichtverletzung belehrt hat. Gemäß § 19 VVG kann ein Versicherer einen Vertrag anfechten und von diesem zurücktreten, wenn ein Versicherungsnehmer die Gesundheitsfragen nicht wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet bzw. nicht auf alle Gefahrenumstände hingewiesen hat. Um dieses Recht auszuüben, muss der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Vertragsabschluss ordnungsgemäß über die Rechtsfolgen einer vorvertraglichen Anzeigenpflichtverletzung belehrt haben (§ 19 Abs. 5 Satz 1 VVG). Rechtsfolgen bei Informationsmangel Eine Ausnahme stellt der Tatbestand der arglistigen Täuschung dar: In seinem Urteil vom 12. März 2014 hat der Bundesgerichtshof klar gestellt, dass der Versicherer, selbst wenn er über die möglichen Folgen von falschen oder fehlenden Angaben im Antragsformular nicht ausreichend belehrt hat, zum Rücktritt vom Versicherungsvertrag berechtigt ist, wenn der Versicherungsnehmer oder der für ihn handelnde Versicherungsvermittler arglistig falsche Angaben im Antrag gemacht hat. Der arglistig handelnde Versicherungsnehmer kann sich dann nicht auf eine Verletzung der Pflicht des Versicherers, ihn über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung zu belehren, berufen (vgl. BGH, Urt. v. 12.3.2014 – IV ZR 306/13). In einem vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart verhandelten Fall (vgl. OLG Stuttgart, Urt. v. 26.9.2013 – 7 U 101/13) musste der Senat darüber entscheiden, ob ein Versicherungsnehmer bei Wechsel zu einer anderen Versicherung bewusst vorvertragliche Erkrankungen (Gonarthrose und arterielle Hypertonie) und deren Behandlungen verschwiegen und den Versicherer arglistig getäuscht hatte. Obwohl der Senat nicht verkannte, dass in erheblichem Umfang Indizien vorlagen, die auf eine arglistige Täuschung seitens des Klägers hindeuteten, ließen entlastende Indizien den Senat letztendlich an der arglistigen Täuschung des Versicherungsnehmers zweifeln. Der Versicherungsvermittler hatte den potenziellen Versicherungsnehmer nämlich auf eigene Initiative mehrfach aufgesucht, um ihn von einem Wechsel zu einer günstigeren Versicherung zu überzeugen. Auf Drängen des Versicherungsvermittlers hatte der Versicherungsnehmer, der angeblich auf alle Vorerkrankungen hingewiesen hatte, schließlich einem Wechsel zugestimmt und das vom Versicherungsvermittler bereits vollständig ausgefüllte Antragsformular unterzeichnet. Unter anderem hatte der Versicherungsvermittler angegeben, dass “allgemeine Kontrolluntersuchungen ohne Befund” gewesen seien. Der Senat gelangte unter anderem aufgrund dieser Angabe zu der Überzeugung, dass dem Versicherungsnehmer die Gesundheitsfragen nicht zur Beantwortung vorlegt worden seien. In seinem Urteil befand das OLG Stuttgart, dass “die üblichen Indizien für Arglist bei unvollständigen Gesundheitsangaben stark entwertet werden”, wenn “ein Kunde im Wege der sogenannten Kaltakquise nach wiederholten Besuchen gewonnen werde”. Ferner urteilte das OLG Stuttgart, dass das Recht der Versicherung zum Rücktritt wegen formal unwirksamer Belehrung ausgeschlossen sei. Die Hinweise auf die Rechtsfolgen falscher Gesundheitsangaben in einem Antragsformular auf der letzten Seite, mehrere Seiten nach der Unterschrift, können bei der Antragstellung leicht übersehen werden und seien aus diesem Grund nicht ausreichend. Die Folge ist, dass der Versicherer nicht vom Versicherungsvertrag zurücktreten kann. Mit dieser Aussage folgte das OLG Stuttgart der gängigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, der bereits mehrfach zu den formalen Anforderungen an eine wirksame Belehrung Stellung genommen hat (vgl. BGH, Urt. v. 9.1.2013 – IV ZR 197/11; BGH, Beschluss v. 11.09.2013 – IV ZR 253/12; OLG Stuttgart, Urt. v. 26.9.2013 – 7 U 101/13). Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem BU-Antrag? Kontaktieren Sie uns! Kostenlose Ersteinschätzung Ihres Falles!
Berufsunfähigkeit: Tipps zur richtigen Antragstellung
Bei der Beantragung einer BU-Rente müssen Versicherungsnehmer zahlreiche Formulare ausfüllen und ärztliche Gutachten einholen, um ihre Berufsunfähigkeit nachzuweisen. Berufsunfähigkeit: Tipps zur richtigen Antragstellung “Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte infolge von Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate außerstande ist, seinen zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen ausgestaltet war, auszuüben und er auch keiner anderen Tätigkeit nachgeht, die seiner bisherigen Lebensstellung bei Ausscheiden aus dem Berufsleben entspricht.” In den meisten Versicherungsbedingungen sind gleichlautende oder ähnliche Formulierungen zu finden. Entscheidend in dem Zusammenhang ist der sogenannte Prognosezeitraum. Wenn zum Beispiel ein Versicherungsnehmer über drei Monate lang nicht seinen Beruf ausüben konnte und in den Versicherungsbedingungen ein Prognosezeitraum von 6 Monaten angegeben ist, kann der Arzt aller Wahrscheinlichkeit nach eine Prognose für die voraussichtliche Dauer der Berufsunfähigkeit stellen. Dennoch wird ein Versicherer zunächst im Detail die Voraussetzungen für den Leistungsfall überprüfen. Neben einer Vielzahl von Formularen, die auszufüllen sind, wird der Versicherte dazu aufgefordert werden, Berichte bzw. Gutachten seiner behandelnden Ärzte vorzulegen. In der Regel müssen die Arztberichte folgende Angaben enthalten: Ursache, Beginn und Art der Erkrankung; Auswirkung der Erkrankung auf die Fähigkeit, den Beruf auszuüben; Grad und voraussichtliche Dauer der Berufsunfähigkeit; Prognose über den Verlauf der Erkrankung; Wenn beispielsweise ein Hausarzt die Berufsunfähigkeit festgestellt und bescheinigt hat, kann es sein, dass der Versicherer weitere Gutachten von spezialisierten Fachärzten einholen möchte. Zudem wird der Versicherer eine Schweigepflichtentbindung gegenüber Ärzten und der Krankenkasse anfordern, die nicht pauschal unterschrieben werden sollte. Der Versicherer muss vielmehr konkretisieren, welche Auskünfte er bei welcher Stelle einholen möchte. Selbst die Bewilligung einer vollen Erwerbsminderungsrente durch die gesetzliche Rentenversicherung reicht keinem privaten BU-Versicherer als Nachweis für eine Berufsunfähigkeit aus. In der Regel überprüfen die meisten Versicherungen im Leistungsfall, ob bei Abschluss der BU-Versicherung tatsächlich alle Gesundheitsfragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet wurden. In vielen Fällen versuchen Versicherer dann, wegen mangelhaft oder falsch beantworteter Gesundheitsfragen vom Vertrag zurückzutreten oder diesen anzufechten. Die häufigsten Gründe, warum Versicherer eine Leistung letztendlich verweigern, sind: ein nicht ausreichender Nachweis der Berufsunfähigkeit; die falsche Beantwortung der Gesundheitsfragen bei Vertragsabschluss, nicht komplett ausgefüllte Formulare und keine Reaktion auf Nachfragen der Versicherung. Der Prozess der Beantragung der BU-Rente ist äußerst komplex, da der Versicherer einen lückenlosen Nachweis der Berufsunfähigkeit verlangt. Um unnötige Fehler beim Ausfüllen der Formulare und ggf. einen Rechtsstreit zu vermeiden, sollte der Antrag mit Unterstützung eines Fachanwalts gestellt werden. Unsere kurze Checkliste für die Beantragung der BU-Rente (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Ausfüllen der allgemeinen Daten im BU-Antragsformular; Darstellung des Eintritts des Leistungsfalles (Monat, Jahr) und Aufführung der Anlagen; Ausführliche Darstellung der Ursache der Berufsunfähigkeit; Detaillierte Berichte der behandelnden Ärzte; Detaillierte Darstellung des Berufs (Berufskunde) mit Aufschlüsselung aller Tätigkeiten nach Zeit; Angabe und Nachweis des Einkommens und Erläuterung der sozialen Stellung, die mit dem Beruf verbunden ist. Die vollständige Übermittlung sämtlicher für den BU-Antrag relevanter Unterlagen ist vor allem auch deshalb wichtig, weil der Versicherer ohne die relevanten Unterlagen nicht in die Prüfung Ihres BU-Antrages gehen wird. Sie können gerne mit uns in Kontakt treten, wenn wir Sie bei der Einreichung Ihres BU-Antrages begleiten sollen.
KG Berlin: Ausschluss von Rentenansprüchen aus der BU-Versicherung bei verweigerter Mitwirkung
KG Berlin Urteil v. 8.7.2014 – 6 U 134/13 Berufsunfähigkeitsversicherung: Ausschluss der Fälligkeit von Versicherungsansprüchen bei verweigerter Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten Leitsätze 1. Die notwendigen Erhebungen des Versicherers zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung gemäß § 14 Abs. 1 VVG umfassen auch die Prüfung der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht; ist dem Versicherer die Einholung von Informationen über Gesundheitsdaten des Versicherungsnehmers aus vorvertraglicher Zeit mangels Erteilung einer Schweigepflichtentbindungserklärung des Versicherungsnehmers nicht möglich, ist dessen Anspruch auf die Versicherungsleistung nicht fällig. 2. Aus § 213 VVG . F. und der zugrunde liegenden Rechtsprechung des BVerfG ergibt sich nicht, dass der Versicherer diese Informationen seit Inkrafttreten des neuen VVG nicht mehr, jedenfalls nur bei einem konkreten Verdacht einer Anzeigepflichtverletzung und/oder nur beschränkt auf solche Gesundheitsdaten einholen darf, die einen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls gehabt haben können. Tenor Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Berlin vom 12. Juni 2013 – 23 O 341/12 – wird auf seine Kosten zurückgewiesen. Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Die Revision zum Bundesgerichtshof wird zugelassen. Gründe I. Der Kläger begehrt Versicherungsleistungen aus einer mit der Beklagten zum 1. April 2009 zustande gekommenen Berufsunfähigkeitsversicherung mit der Behauptung, er sei seit dem 6. Mai 2010 wegen einer depressiven Erkrankung und eines “Burn-Out Syndroms” bedingungsgemäß berufsunfähig in seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit als Bezirksleiter der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen. Das Landgericht hat die Klage mit am 26. Juni 2013 zugestelltem Urteil, auf das wegen seiner tatsächlichen Feststellungen gemäß § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, als derzeit unbegründet abgewiesen und dies damit begründet, dass die Beklagte ihre Leistungsprüfung nicht abschließen könne, nachdem der Beklagte mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 27. Juli 2012 (Anlage K 22) ausdrücklich der Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch die Beklagte widersprochen hatte, “soweit das die Überprüfung vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzungen betrifft”. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Begründung der angefochtenen Entscheidung verwiesen. Mit Schriftsatz vom 22. Juli 2013, eingegangen am 23. Juli 2013, hat der Kläger gegen das Urteil Berufung eingelegt und diese – nachdem auf seinen am 23 August 2013 eingegangenen Antrag die Frist bis zum 26. September 2013 verlängert worden war – mit am 20. September 2013 eingegangenem Schriftsatz begründet. Der Kläger rügt eine unzutreffende Rechtsanwendung durch das Ausgangsgericht. Er ist der Ansicht, auch nach den in den Versicherungsvertrag einbezogenen Versicherungsbedingungen nicht verpflichtet zu sein, der Beklagten die Prüfung einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung zu ermöglichen, zumal die Beklagte trotz Nachfrage weder einen konkreten Verdacht noch einen hinreichend konkreten Anhaltspunkt für eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung aufzeigen könne. Der Kläger bestreitet eine solche und behauptet, erstmals im Frühjahr 2010 Anzeichen für eine psychische Erkrankung verspürt zu haben. Der Kläger ist weiter der Ansicht, die angegriffene Entscheidung stehe im Widerspruch zu der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur informationellen Selbstbestimmung und zur Regelung des § 213 VVG, wonach insbesondere persönliche Gesundheitsdaten besonderen Schutz genießen. Der Kläger beantragt, I. das Urteil des Landgerichts Berlin – 23 O 341/12 – vom 12. Juni 2013 wie folgt abzuändern: 1. die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 32.112,48 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus einem Teilbetrag von 27.548 € seit dem 1.6.2012, aus einem Teilbetrag von jeweils weiteren 1141,12 € seit dem 1. eines jeden Monats ab dem 01.07.2012 bis einschließlich 01.10.2012 zu zahlen; 2. die Beklagte wird verurteilt an den Kläger aus der Berufsunfähigkeitsversicherung zur Vers.-Nr. 3… beginnend ab 01.11.2012 bis längstens 31.03.2024 bis zum 1. eines jeden Monats jeweils eine Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von 1060,90 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz und zwar ab dem 2. des jeweiligen Monats zu zahlen; 3. es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, über das Jahr 2012 hinaus die monatliche Berufsunfähigkeitsrente jährlich zu erhöhen, jeweils zum 01. 04. eines jeden Jahres, längstens bis zum 31.03.2024, jeweils um 3 % der Rente des Vorjahres; die die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von der Prämienzahlungspflicht für die Berufsunfähigkeitsversicherung zur Vers.-Nr. 3… ab dem 1.11.2012 bis längstens zum 31.03.2024 freizustellen. II. Hilfsweise, das Urteil des Landgerichts Berlin – 23 O 341/12 – vom 12. Juni 2013 aufzuheben und den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen. III. Hilfsweise wird angeregt, die Revision zuzulassen. Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Sie ist der Ansicht, im Rahmen der Feststellung des Versicherungsfalls auch berechtigt zu sein, Gesundheitsdaten des Versicherungsnehmers aus der Zeit vor Abschluss des Versicherungsvertrages zu erheben, um zum einen klären zu können, ob sich das versicherte Risiko schon vorvertraglich verwirklicht hatte und zum anderen um zu prüfen, ob ihr wegen einer Anzeigepflichtverletzung ein Recht zur Anfechtung des Versicherungsvertrages oder zum Rücktritt vom Versicherungsvertrag zustehe, weil auch diese Fragen ihre Leistungspflicht beträfen. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stehe dem – schon wegen der vorzunehmenden Interessenabwägung – nicht grundsätzlich entgegen. Das Widerspruchsrecht des Ver-sicherungsnehmers gemäß § 213 Abs. 2, 2. Hs. VVG sichere lediglich den verfassungs-rechtlich geschützten Anspruch des Versicherungsnehmers auf Schutz seiner persönlichen Daten, begründe aber keinen Anspruch auf die Versicherungsleistung unabhängig von einer Anspruchsprüfung durch den Versicherer. Ein konkreter Verdacht für eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung sei für die Datenerhebung aus vorvertraglicher Zeit nicht erforderlich, unabhängig davon ergebe sich dieser vorliegend bereits aus dem engen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Antragstellung und dem behaupteten Eintritt der Berufsunfähigkeit, zumal die Erkrankung des Klägers an einer Depression in Form eines “Burnout-Syndroms” eine längere Krankheitsentwicklung belege. II. Die Berufung des Klägers vom 22. Juli 2013 ist zulässig, sie ist insbesondere form- und fristgemäß eingelegt (§§ 517, 519 ZPO) und – im Hinblick auf die Verlängerung der Frist bis zum 26. September 2013 – begründet (§ 520 ZPO) worden. In der Sache bleibt die Berufung des Klägers jedoch ohne Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht die Klage auf Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung als “derzeit unbegründet” abgewiesen. Die hiergegen
Selbstständige: Pflicht zur Umorganisation in der Berufsunfähigkeit?
Wem als Selbstständiger die Berufsunfähigkeit droht, für den gelten andere Erfordernisse als für normale Arbeitnehmer. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Pflicht zur Umorganisation in der Berufsunfähigkeit, die grundsätzlich für Selbständige gilt. Doch was genau versteht sich unter dem Stichwort Umorganisation? Und ist jeder Selbständige auch zur Umorganisation verpflichtet?
Auskunftspflicht des Versicherungsnehmers und Entbindung von ärztlicher Schweigepflicht
In der Regel überprüfen Versicherer im Leistungsfall, ob vorvertragliche Anzeigepflichten verletzt worden sind. Muss der Versicherungsnehmer solche Ermittlungen durch eine Schweigepflichtentbindungserklärung unterstützen? Ob eine Berufsunfähigkeitsversicherung die vertraglich vereinbarte Leistung im Versicherungsfall zahlen muss, hängt maßgeblich davon ab, ob der Versicherte bei Abschluss des Vertrages die Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet hat. In der Regel überprüfen Versicherer, ob vorvertragliche Anzeigepflichten verletzt worden sind. Um gesundheitsbezogene Daten aus vorvertraglicher Zeit bei behandelnden Ärzten, Krankenhäusern, Krankenkassen oder anderen Einrichtungen einzuholen, benötigt der Versicherer eine sogenannte Schweigepflichtentbindungserklärung, das heißt, der Versicherungsnehmer muss die in Frage kommenden Personen und Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht entbinden. Berufsunfähigkeitsversicherung Nach einem Urteil des Kammergerichts Berlin vom 8.7.2014 (6 U 134/13) umfassen die notwendigen Erhebungen des Versicherers zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung gemäß § 14 Abs. 1 VVG auch die Prüfung der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. Wenn der Versicherungsnehmer, wie im gerichtlich verhandelten Fall, eine Entbindung von der Schweigepflicht verweigert und der Versicherer deshalb keine Gesundheitsdaten aus vorvertraglicher Zeit einholen kann, besteht nach Ansicht des Gerichtes kein Anspruch auf die Versicherungsleistung. Das Kammergericht ist dem vorhergehenden Urteil des Landgerichts (LG Berlin, 12.6.2013 – 23 O 341/12) dahingehend gefolgt, dass der Anspruch auf die Versicherungsleistung im Sinne des § 14 VVG nicht fällig ist, da der Versicherer aufgrund des Widerspruchs des Versicherungsnehmers gegen die beabsichtigte Erhebung von Gesundheitsdaten aus vorvertraglicher Zeit seine Leistungsprüfung nicht abschließen kann. In der Vorentscheidung hatte das Landgericht Berlin es offen gelassen, ob die Erforderlichkeit der Datenerhebung eine hinreichend konkrete Verdachtslage erfordert. Das Kammergericht beschäftigte sich ausführlich mit der Frage, ob § 213 VVG bzw. die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Erhebung von Gesundheitsdaten aus vorvertraglicher Zeit entgegensteht und verneinte dieses (vgl. BVerfG, Beschl. v. 23.10.2006 – 1 BvR 2027/02; BVerfG, Beschluss vom 17. Juli 2013 – 1 BvR 3167/08). Zudem distanzierte sich das Gericht von der von Egger (VersR 2014, 553; VersR 2012, 810) vertretenen Auffassung, dass dem Versicherer im Rahmen der Leistungsprüfung allein das Recht zustünde, Daten zu der Frage zu erheben, ob sich das versicherte Risiko verwirklicht habe. Zwar wird mit § 213 VVG der Schutz des Persönlichkeitsrechts des Versicherungsnehmers in Form eines Selbstbestimmungsrechts über die Gesundheitsdaten gewährleistet, aber im vorliegenden Fall nahm das Kammergericht Berlin eine Abwägung vor und räumte dem Ermittlungsinteresse des Versicherers Vorrang ein. Das Kammergericht hat die Revision zum Bundesgerichtshof wegen der grundsätzlichen Bedeutung der entscheidungsrelevanten Fragen zugelassen, insbesondere unter welchen Voraussetzungen und im welchem Umfang der Versicherer unter Berücksichtigung des § 213 VVG und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Gesundheitsdaten aus vorvertraglicher Zeit erheben darf. Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem BU-Antrag? Kontaktieren Sie uns! Kostenlose Ersteinschätzung Ihres Falles!
Anforderungen an eine wirksame Belehrung nach § 19 Abs. 5 S. 1 VVG
Die Rücktritts-, Kündigungs- oder Anpassungsrechte des Versicherers aus § 19 Abs. 2 – 4 VVG setzten gemäß § 19 Absatz 5 S. 1 VVG voraus, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung durch „gesonderte Mitteilung in Textform“ belehrt hat. Gemäß § 19 Absatz 1 VVG ist der Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung dazu verpflichtet, alle gefahrerheblichen Umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat. Das heißt, der Versicherungsnehmer muss die für den Versicherer erheblichen Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wenn der Versicherungsnehmer diese Anzeigepflicht verletzt, kann der Versicherer, abhängig vom Verschulden des Versicherungsnehmers, gemäß § 19 Absatz 2 – 4 VVG vom Vertrag zurücktreten (vorsätzliche oder grob fahrlässige Nichtanzeige), kündigen oder den Vertrag anpassen (fahrlässige Nichtanzeige). Um im Versicherungsfall ein Rücktritts-, Kündigungs- oder Anpassungsrecht beanspruchen zu können, muss der Versicherer den Versicherungsnehmer vor Vertragsschluss durch eine gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wenn diese Belehrung durch gesonderte Mitteilung in Textform nicht erfolgt oder wenn sie aus anderen Gründen nicht wirksam ist, dann stehen dem Versicherer die vorgenannten Rechte nicht zu, selbst wenn ggf. eine Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Der Versicherer trägt auf jeden Fall die Darlegungs- und Beweislast für die ordnungsgemäße Belehrung gemäß § 19 Absatz 5 S. 1 VVG. Welchen formalen Kriterien muss nun eine gesonderte Mitteilung in Textform genügen? Nach § 19 Absatz 5 S. 1 VVG erfordert die gesonderte Mitteilung in Textform über die Folgen vorvertraglicher Anzeigepflichten nicht automatisch die Erstellung eines gesonderten Dokuments. Wenn ein Versicherer sich nun dazu entschließt, diesen Belehrungstext in das Antragsformular zu integrieren, muss er bestimmten formalen Anforderungen gerecht werden, um sicherzustellen, dass der Antragsteller diesen Hinweis auch zur Kenntnis nehmen kann. Ein Praxisbeispiel: Obwohl eine gesonderte Mitteilung in Textform in einem Antragsformular den Gesundheitsfragen vorangestellt war, ein Hinweis sich in der Rubrik „Schlusserklärungen und Unterschriften“ befand und ein weiterer Hinweis in einer zusätzlichen „Erklärung zum Antrag“, kam das Oberlandesgericht Hamm zu dem Schluss, dass dem Versicherer kein Rücktrittsrecht zustehe, weil sie den Versicherungsnehmer nicht ordnungsgemäß im Sinn von § 19 Abs. 5 S. 1 VVG belehrt habe (vgl. OLG Hamm, Urt. v. 13.2.2015 – 20 U 169/14; vgl. auch OLG Stuttgart, Urt. v. 13.3.2014 – 7 U 216/13). Das Oberlandesgericht führt unter anderem aus, dass bei Aufnahme eines Belehrungstextes in ein Antragsformular oder in eine gesondert unterzeichnete Erklärung dieser Belehrungstext drucktechnisch so gestaltet sein müsse, dass er sich deutlich abhebe und nicht übersehen werden könne. Der Belehrungstext unterscheide sich aber weder in Hinblick auf die durchwegs kleine Schriftgröße noch auf die Schriftart oder die fettgedruckten Überschriften vom übrigen Text. Für einen durchschnittlichen Versicherungsnehmer gehe dieser Belehrungstext im übrigen Text vollständig unter. Mit diesem Urteil folgte das Oberlandesgericht Hamm der gängigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, der bereits zuvor formale Anforderungen an eine wirksame Belehrung mehrfach formuliert hatte (vgl. BGH, Urt. v. 9.1.2013 – IV ZR 197/11; BGH, Beschluss v. 11.09.2013 – IV ZR 253/12; OLG Stuttgart, Urt. v. 26.9.2013 – 7 U 101/13). Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem BU-Antrag? Kontaktieren Sie uns! Kostenlose Ersteinschätzung Ihres Falles!
Ablehnungsquoten der Versicherer: Häufigste Streitfälle bei BU-Rente
Die häufigsten Streitfälle bei der Beantragung von Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung drehen sich um vorvertragliche Anzeigenpflichtverletzungen und das Nichterreichen der 50 Prozent Hürde. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) werden 70 Prozent aller Leistungsanträge anerkannt, das heißt, die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente wird bezahlt. Das bedeutet allerdings auch auf der Kehrseite, dass bei 30 Prozent der Fälle der Versicherer nicht reguliert, also den Anspruch auf eine BU-Rente ablehnt. Einige Experten der Versicherungswirtschaft gehen sogar von Ablehnungsquoten zwischen 30 % und 60 % aus. Bei 11 Prozent der Anträge sollen die Versicherer dabei eine dauerhafte Berufsunfähigkeit von mindestens 50 Prozent bezweifeln, bei 7 Prozent vermuten sie eine nicht vollständige bzw. nicht wahrheitsgemäße Beantwortung der Gesundheitsfragen. Einige Berufsunfähigkeitsversicherer stellen inzwischen ihre (niedrigen) Prozessquoten, d.h. die Quote, in denen Ansprüche nach der Ablehnung gegen den Versicherer durch den Versicherungsnehmer gerichtlich geltend gemacht werden müssen, als Qualitätsmerkmal heraus. Man sollte diesen Quoten mit einer gewissen Vorsicht begegnen – die Daten werden nicht selten selektiv verwendet und sind für das Regulierungsverhalten des Versicherers nur eingeschränkt aussagekräftig. 50 Prozent Hürde Nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 172 Abs. 2 VVG gilt jemand als berufsunfähig, wenn er “seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz oder teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht mehr ausüben kann”. Bei Beantragung der vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen muss der Versicherungsnehmer in der Regel mit Hilfe eines medizinischen Gutachtens nachweisen, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung ihn dauerhaft daran hindert, den konkreten Beruf zu mindestens 50 Prozent auszuüben. Häufig kommt es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, weil Versicherungen bezweifeln, dass ein Versicherungsnehmer dauerhaft, das heißt, abhängig von den konkreten Vertragsbedingungen mindestens sechs Monate lang zu mindestens 50 Prozent seinen Beruf nicht ausüben konnte bzw. auch in Zukunft nicht ausüben wird. Problematisch in diesem Kontext sind zudem Verweisungsklauseln, insofern der Vertrag solche enthält. So kann zum Beispiel eine konkrete Verweisungsklausel bewirken, dass der Versicherer die Zahlung einer BU-Rente ablehnt, wenn der Versicherte auf einen Vergleichsberuf verwiesen werden, unter der Voraussetzung, dass er diesen gesundheitlich ausüben kann. Im Streitfall muss der Versicherer einen Vergleichsberuf oder mehrere Vergleichberufe anführen unter präziser Angabe vergleichbarer prägender Merkmale wie Ausbildung, Arbeitsbedingungen, Gehalt, erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse (vgl. BGH, Urt. v. 12.1.2000 – IV ZR 85/99; BGH, Urt. v. 29.6.1994 – IV ZR 129/93). Im Falle einer abstrakten Verweisungsklausel muss der Versicherungsnehmer nicht nur eine Berufsunfähigkeit für den aktuell ausgeübten Beruf nachweisen, sondern auch für einen Vergleichsberuf – selbst wenn der Versicherungsnehmer diesen bei Beantragung einer BU-Rente gar nicht ausübt (vgl. BGH, Urt. v. 3.11.1993 – IV ZR 185/92). Vorvertragliche Anzeigenpflichtverletzung Im Versicherungsfall nehmen Versicherer in den meisten Fällen eine genauere Überprüfung der im Gesundheitsbogen aufgeführten bzw. möglicherweise verschwiegenen Vorerkrankungen vor. Sofern die bei der Antragstellung gemachten Angaben unvollständig sind oder nicht mit den Angaben in den von Krankenkassen und Ärzten angeforderten Akten übereinstimmen, wird der Versicherer die Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente zunächst verweigern. Eine Einwilligung des Versicherungsnehmers zur Erhebung seiner Gesundheitsdaten (§ 213 VVG) vorausgesetzt, hat der Bundesgerichtshof mehrfach die Überprüfung von Vorerkrankungen nach Abwägung der Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherers für zulässig erklärt (vgl. BGH, Beschluss vom 21.09.2011 – IV ZR 203/09). Im Streitfall ist dann unter anderem zu klären, ob der Versicherungsnehmer bei der Beantwortung der Fragen ohne Verschulden, einfach fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich bzw. arglistig gehandelt hat. Bei Ablehnung eines Leistungsantrags aufgrund von vermuteter vorvertraglicher Anzeigenpflichtverletzung, bei angezweifelter dauerhafter Berufsunfähigkeit von mindesten 50 Prozent und versuchter konkreter bzw. abstrakter Verweisung auf einen Vergleichsberuf empfehlen Verbraucherschutzorganisationen unbedingt, fachanwaltliche Hilfe zwecks genauer Überprüfung der Leistungsablehnung des Berufsunfähigkeitsversicherers in Anspruch zu nehmen. Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem BU-Antrag oder bei der Geltendmachung von Leistungen aus Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Ersteinschätzung Ihres Falles
Nachprüfungsverfahren in der BU-Versicherung – Pflichten des Versicherungsnehmers
Nach Anerkenntnis der bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit und Zahlung der vereinbarten Leistung, ist der Versicherer regelmäßig berechtigt, den Grad der Berufsunfähigkeit einmal im Jahr zu überprüfen. Der Versicherungsnehmer ist dabei verpflichtet, sich im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens ärztlich untersuchen zu lassen. Nach Anerkennung der Leistungspflicht haben BU-Versicherer das Recht, den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Rentenleistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung zu überprüfen. Die Aufforderung, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, dient der Vorbereitung der Entscheidung, ob der Versicherer weiterhin gemäß seinem Leistungsanerkenntnis die vertragsgemäßen Leistungen erbringen muss oder ob er zu einer Leistungseinstellung berechtigt ist. Den Versicherungsnehmer trifft in diesem Rahmen eine besondere Mitwirkungspflicht, dessen Verletzung weitreichende Folgen haben kann: So stellte das OLG Köln in einem Urteil vom 19.7.2013 eine grob fahrlässige Verletzung der Nachuntersuchungsobliegenheit eines Versicherungsnehmers fest, der trotz formal korrekter Aufforderung durch seinen Versicherer nicht am Nachprüfungsverfahren mitgewirkt hatte. Die Versicherung hatte daraufhin – zu Recht – die Zahlung ihrer Rentenleistungen eingestellt (vgl. OLG Köln, Urt. v. 19.7.2013 – 20 U 26/11). Nachprüfungsverfahren BU Versicherung Geregelt ist das Nachprüfungsverfahren unter anderem in den Allgemeinen Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ-2008) als auch in den Allgemeinen Bedingungen zur Berufsunfähigkeitsversicherung (AB-BUV-2008). Gemäß § 6 Abs. 2 der BUZ-2008 bzw. § 13 Abs. 2 AB-BUV-2008 ist der Versicherer berechtigt, “auf unsere (d.h. des Versicherers) Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten Person durch von uns (d.h. des Versicherers) zu beauftragende Ärzte verlangen.” Der folgende § 6 Abs. 3 BUZ-2008 bzw. § 13 Abs. 3 AB-BUV-2008 regelt dabei die Anzeigepflichten des Versicherten, indem er bestimmt: “Eine Minderung der Berufsunfähigkeit oder der Pflegebedürftigkeit und die Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit müssen sie uns unverzüglich mitteilen.” Im zitieren Fall hatte der Versicherte nach dem Anerkenntnis seiner Berufsunfähigkeit auf Grund von Innenohrschwerhörigkeit seit dem Februar 1988 Leistungen aus seiner Berufsunfähigkeitsversicherung bezogen. Bereits 1998 hatte die Versicherung erfolglos versucht, die Leistungen einzustellen. Im März 2005 forderte der BU-Versicherer den Versicherungsnehmer erneut zu einer uneingeschränkten Nachuntersuchung auf und teilte ihm schriftlich drei Terminvorschläge mit. Wegen “anderweitiger Belegung” nahm der Versicherungsnehmer die Termine nicht wahr; als Gründe gab er eine Urlaubsreise und einen Zahnarzttermin an. Zudem vertrat der er die Ansicht, dass die ärztliche Untersuchung auf jene Gesundheitsbeeinträchtigungen zu beschränken sei, die zum Anerkenntnis seiner Berufsunfähigkeit geführt haben. Dementgegen befand das Oberlandesgericht Köln, in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, dass eine umfassende ärztliche Untersuchung des Versicherungsnehmers dem Versicherer grundsätzlich gestattet sei (vgl. BGH, Urt. v. 17.02.1993 – IV ZR 162/91; Urt. v. 17.02.1993 – IV ZR 228/91). Nur wenn der Gesundheitszustand sich nicht verändert habe bzw. unveränderbar sei, müsse bei fehlender Erforderlichkeit von einer umfassenden Untersuchung abgesehen werden (vgl. hierzu auch OLG Bremen, Urt. v. 22.08.2011 – 3 U 12/11). Das Oberlandesgericht Köln stellte klar, dass der Versicherungsnehmer dem Versicherer zeitgerecht die Hinderungsgründe mitteilen müsse, wenn er die vom Versicherer bzw. vom Arzt vorgeschlagenen Untersuchungstermine nicht wahrnehmen könne. Auch müsse sich der Versicherungsnehmer bemühen, einen Termin für eine Untersuchung mit der Versicherung zu vereinbaren, vor allem, wenn in der Vergangenheit alle Versuche einer Terminfindung gescheitert seien. Das Oberlandesgericht Köln gelangte zu dem Urteil, dass der Versicherer für den Zeitraum der Verletzung der Mitwirkungsobliegenheit keine Leistungen an den Versicherungsnehmer zahlen müsse, da der Versicherungsnehmer in diesem Zeitraum die Mitwirkungspflicht grob fahrlässig verletzt habe. Auch teilte das Oberlandesgericht Köln die Auffassung des Landgerichts Köln, das erstinstanzlich befunden hatte, dass an die Aufforderung zur Nachuntersuchung keine besonderen formalen Anforderungen zu stellen seien, da dies in den einschlägigen Versicherungsbedingungen nicht vorgesehen sei (vgl. Landgericht Köln, Urt. vom 29.12.2010 – 26 O 132/09). Im Rahmen der Verletzung der Mitwirkungspflicht aufgrund eines groben fahrlässigen Verstoßes ist der Versicherer berechtigt, die Kürzung von Rentenzahlungen – auch rückwirkend – festzustellen bzw. diese erstattet zu verlangen. Rentenleistungen aus der BU-Versicherung werden zudem während der Dauer der Obliegenheitsverletzung des Versicherten nicht fällig. Bei einem vorsätzlichen Verstoß gegen eine Mitwirkungspflicht, welcher jedoch durch die Versicherung zu beweisen ist, kann diese von der Leistungspflicht befreit werden (vgl. § 28 Abs. 2 S. 1 VVG i.V.m. den jeweiligen Versicherungsbedingungen der Berufsunfähigkeitsversicherung).
Kenntnis und Textform der Antragsfragen bei Beantragung einer BU-Versicherung
Beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung muss der Versicherungsnehmer nach § 19 Abs. 1 S. 1 VVG nur solche Gesundheitsfragen beantworten, die der Versicherer ihm in Textform gestellt hat (§ 126 b BGB). Ein Versicherungsunternehmen möchte vor dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung die Gefahr eines Schadenseintritts bestmöglich einschätzen können: Deshalb darf der Versicherer den Antragsteller nach gefahrerheblichen Umständen, also solchen Umständen, welche für seine Risikoeinschätzung erheblich sind, befragen. Doch nur wenn der Versicherer sogenannte Gefahrenumstände im Sinne von § 19 Abs. 1 S.1 VVG in Textform erfragt, kann er sich im Versicherungsfall auf eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung berufen. Der Versicherer ist also dazu verpflichtet, dem Antragsteller einen vollständigen Zugang zum Inhalt des Antragsformulars in Textform zu ermöglichen. Entsprechend der gesetzlichen Definition in § 126b BGB ist Textform nur gewahrt, sofern die Fragen dem Versicherungsnehmer in einer zur dauerhaften Wiedergabe geeigneten Weise in Schriftzeichen gestellt werden. Textform erfordert somit, dass der Antragsteller die Gesundheitsfragen verkörpert vor Augen hat, sie also ggf. mitlesen kann, unabhängig davon, ob er sie auch tatsächlich mitliest. Wenn nun der Antragsteller den Fragenbogen eines Versicherers selbst ausfüllt, kann davon ausgegangen werden, dass er die Fragen in Textform vollständig zur Kenntnis genommen hat. Die nicht wahrheitsgemäße oder unvollständige Beantwortung von Fragen würde im Versicherungsfall und bei der Berufung auf vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung zu seinen Lasten gehen. Anders gestaltet sich die Situation, wenn ein Antragsteller und ein Versicherungsvermittler gemeinsam einen Fragebogen ausfüllen. Hier sind in der Praxis verschiedene Szenarien denkbar. Im Idealfall liest der Versicherungsvermittler beispielsweise die Fragen vollständig vor, lässt den Antragsteller am Laptop oder auf einem Papierausdruck die Fragen mitlesen und fordert ihn anschließend auf, den gemeinsam am Laptop ausgefüllten Fragenbogen nochmals ohne Zeitdruck in ausgedruckter Form durchzulesen. Wenn ein Versicherungsvermittler so vorgeht, entspricht er dem Textformerfordernis im Sinne von § 19 Abs. 1 S. 1, da der künftige Versicherungsnehmer die Fragen in zweifacher Form – am Laptop sowie auf dem Ausdruck – unzweifelhaft verkörpert vor Augen hat. Dagegen genügt das bloße Vorlesen von Gesundheitsfragen durch den Versicherungsmittler, ohne dem Antragsteller eine Möglichkeit zu geben, selbst die Fragen mitzulesen, grundsätzlich nicht (vgl. LG Berlin, Urteil v. 25.1.2013 – 23 O 238/11). Sofern ein Versicherungsvermittler Fragen umformuliert, Fragen auslässt oder deren Sinn verfälscht, also die mündlich gestellten Fragen von den schriftlichen Gesundheitsfragen stark abweichen, so ist das Textformerfordernis des §19 Abs. 1 VVG i.V.m. § 126 b BGB ebenfalls nicht gewahrt und der Versicherer kann sich im Falle eines Versicherungsfalles nicht auf eine vermeintliche vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung berufen. Im Falle der digitalen Aufnahme eines Versicherungsantrages, z.B. über einen Laptop oder ein Tablet, hat die Stellung der Gesundheitsfragen im Falle einer mündlichen Befragung durch den Versicherungsvertreter und der Aufnahme der Antworten auf dessen Laptop auf eine Art und Weise zu erfolgen, so dass das Ausfüllen des Formulars durch den Versicherungsvermittler einer „eigenverantwortlichen Beantwortung“ durch den Antragsteller entspricht. Eine eigenverantwortliche Beantwortung impliziert das vollständige Vorlesen der Fragen ohne Zeitdruck und die Möglichkeit des Antragstellers, Rückfragen zu stellen und Fragen im Einzelnen zu besprechen. Dabei gilt: Selbst wenn der Versicherungsvermittler Gesundheitsfragen nicht vollständig oder korrekt vorliest, den Antragsteller aber aufgefordert hat, die Fragen am Bildschirm bzw. im Papierformular mitzulesen, so ist von der Einhaltung der Textform auszugehen. Schließlich sind dem Versicherungsnehmer die Antragsfragen vor der Unterzeichnung des Versicherungsantrages in dauerhaft lesbarer Form zur Verfügung zu stellen (vgl. BGH, Urt. v. 24.11.2010 – IV ZR 252/08). Dies kann durch einen Ausdruck der Fragen erfolgen, durch eine Übergabe auf einem Datenstick oder durch die Versendung per E-Mail. Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem BU-Antrag? Kontaktieren Sie uns! Kostenlose Ersteinschätzung Ihres Falles!
Kulanzleistung BU-Rente – Wann gilt die Leistungspflicht als anerkannt?
Nach einem Urteil des Landgerichts Dortmund vom 6.2.2014 kann ein Versicherungsnehmer die in einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung festgelegten Leistungen einfordern, wenn der Versicherer nach Leistungsprüfung auf Grund der ihm zu diesem Zeitpunkt vorliegenden ärztlichen Berichte und Gutachten verpflichtet gewesen wäre, das nach den vereinbarten Bedingungen gebotene Leistungsanerkenntnis abzugeben (vgl. LG Dortmund, Urt. v. 6.2.2014 – 2 O 249/13). Auf Basis einer Risikolebensversicherung hatte eine Arzthelferin eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung abgeschlossen. Der behandelnde Arzt diagnostizierte psychische Erschöpfung und schrieb sie im Januar 2012 krank. Im Juli 2012 beantragte die Arzthelferin die in ihrer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung festlegten Leitungen – die vertraglich vereinbarte monatliche Berufsunfähigkeitsrente und eine Beitragsbefreiung. Während des Leistungsprüfungsverfahrens zahlte der Versicherer als Kulanzleistung zunächst vorbehaltlich die vereinbarte BU-Rente, deren Zahlung er zu einem späteren Zeitpunkt wieder einstellte, mit der Begründung, dass die Versicherungsnehmerin wieder arbeitsfähig sei. Im Rahmen des Verfahrens vor dem Landesgericht Dortmund führte die Versicherungsnehmerin aus, dass sie mehr als sechs Monate ohne Unterbrechung krankgeschrieben gewesen und somit gemäß der Versicherungsbestimmungen berufsunfähig gewesen sei. Das Landgericht Dortmund schloss sich in seinem Urteil der Auffassung der Arzthelferin an, da sich aus den zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung eindeutig ergebe, dass eine Berufsunfähigkeit nicht nur dann vorliege, wenn die versicherte Person voraussichtlich sechs Monate lang ununterbrochen nicht in der Lage sei, ihren Beruf auszuüben, sondern auch dann, wenn die versicherte Person sechs Monate ununterbrochen krankheitsbedingt außerstande gewesen sei, ihren Beruf auszuüben. Ausdrücklich verwies das Landgericht auf ein sozialmedizinisches Gutachten des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und einen ärztlichen Bericht des Hausarztes, die beide die Arbeitsunfähigkeit der Versicherungsnehmerin von mindestens sechs Monaten bestätigt und zudem einen Zeitpunkt angegeben hätten, zu dem die Versicherungsnehmerin voraussichtlich wieder arbeitsfähig sei. Mit Bezug darauf stellte das Landgericht fest, dass in Anwendung dieser vertraglichen Vereinbarungen der Versicherer das in § 5 BB-BUZ (allgemeine Bedingungen der Berufsunfähigkeitsversicherung / Stand 1992) geregelte Leistungsanerkenntnis hätte aussprechen müssen, zumal ihm das Gutachten und der Bericht vorgelegen hätten. Wenn aber der Versicherer ein nach den Bedingungen gebotenes Leistungsanerkenntnis nicht abgebe, dann würde sein gebotenes Anerkenntnis fingiert mit der Folge, dass der Versicherer verpflichtet sei, die bedingungsgemäßen Leistungen – im vorliegenden Fall monatliche Rente und Beitragsbefreiung – zu erbringen (vgl. hierzu BGH, Beschluss v. 7.7.2010 – IV ZR 63/08; OLG Karlsruhe, Urt. v. 21.7.2011 – 12 U 55/11; OLG Saarbrücken, Urt. v. 14.11.2012 – 5 U 343/10-55) Eine Beendigung der Leistungspflicht hätte der Versicherer nur über ein Nachprüfungsverfahren erwirken können, das aber nicht durchgeführt wurde.