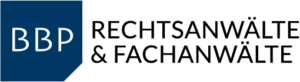Berufsunfähigkeit: Tipps zur richtigen Antragstellung
Bei der Beantragung einer BU-Rente müssen Versicherungsnehmer zahlreiche Formulare ausfüllen und ärztliche Gutachten einholen, um ihre Berufsunfähigkeit nachzuweisen. Berufsunfähigkeit: Tipps zur richtigen Antragstellung “Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte infolge von Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate außerstande ist, seinen zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübten Beruf, so […]
KG Berlin: Ausschluss von Rentenansprüchen aus der BU-Versicherung bei verweigerter Mitwirkung
KG Berlin Urteil v. 8.7.2014 – 6 U 134/13 Berufsunfähigkeitsversicherung: Ausschluss der Fälligkeit von Versicherungsansprüchen bei verweigerter Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten Leitsätze 1. Die notwendigen Erhebungen des Versicherers zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung gemäß § 14 Abs. 1 VVG umfassen auch die Prüfung der Verletzung der vorvertraglichen […]
Ablehnungsquoten der Versicherer: Häufigste Streitfälle bei BU-Rente
Die häufigsten Streitfälle bei der Beantragung von Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung drehen sich um vorvertragliche Anzeigenpflichtverletzungen und das Nichterreichen der 50 Prozent Hürde. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) werden 70 Prozent aller Leistungsanträge anerkannt, das heißt, die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente wird bezahlt. Das bedeutet allerdings auch auf der Kehrseite, dass bei 30 Prozent […]
Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?
Bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit setzt voraus, dass der körperlich-geistige Gesamtzustand des Versicherungsnehmers keine günstige Prognose für die Wiederherstellung von verloren gegangenen Fähigkeiten in einem überschaubaren Zeitraum zulässt […]
GDV-Statistik: Zahlen lassen sich nicht verifizieren
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV) hat am 6. Januar 2016 erstmals eine Branchenstatistik zur Berufsunfähigkeitsversicherung veröffentlicht, welche die anhaltende Kritik an der mangelnden Leistungsbereitschaft von BU-Versicherern aber nicht entkräften kann. In den letzten Jahren ist die mangelnde Leistungsbereitschaft von BU-Versicherern verstärkt in den Fokus der medialen Berichterstattung geraten: die Versicherer würden zu viele Leistungsanträge […]
Dürfen BU-Versicherer ihre Kunden überwachen lassen?
Nach einem Urteil des Oberlandesgerichtes Köln vom 3. August 2012 dürfen BU-Versicherer Kunden verdeckt observieren lassen, wenn konkrete Anzeichen vorliegen, dass der Versicherungsnehmer sich vertragswidrig verhält. Bei einem vor dem OLG Köln verhandelten Berufungsverfahren (OLG Köln, Urt. v. 3.8.2012 – 20 U 98/12), dem ein Verfahren am Landgericht Bonn vorausgegangen war, verlangte ein Versicherungsnehmer unter […]
Prozess wegen BU-Rente: Sind Kosten steuerlich absetzbar?
Mit dem modifizierten § 33 Absatz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) hat der Gesetzgeber 2013 die Absetzbarkeit von Prozesskosten als außergewöhnliche Belastung sehr eingeschränkt. Dennoch können Prozesskosten im Falle eines Rechtsstreits wegen Ablehnung einer BU-Rente unter bestimmten Bedingungen als Werbungskosten steuerlich abgesetzt werden. Betrifft ein Zivilprozess das Versicherungsrecht, könnten die Kosten zum Beispiel für Prozesse im Rahmen […]